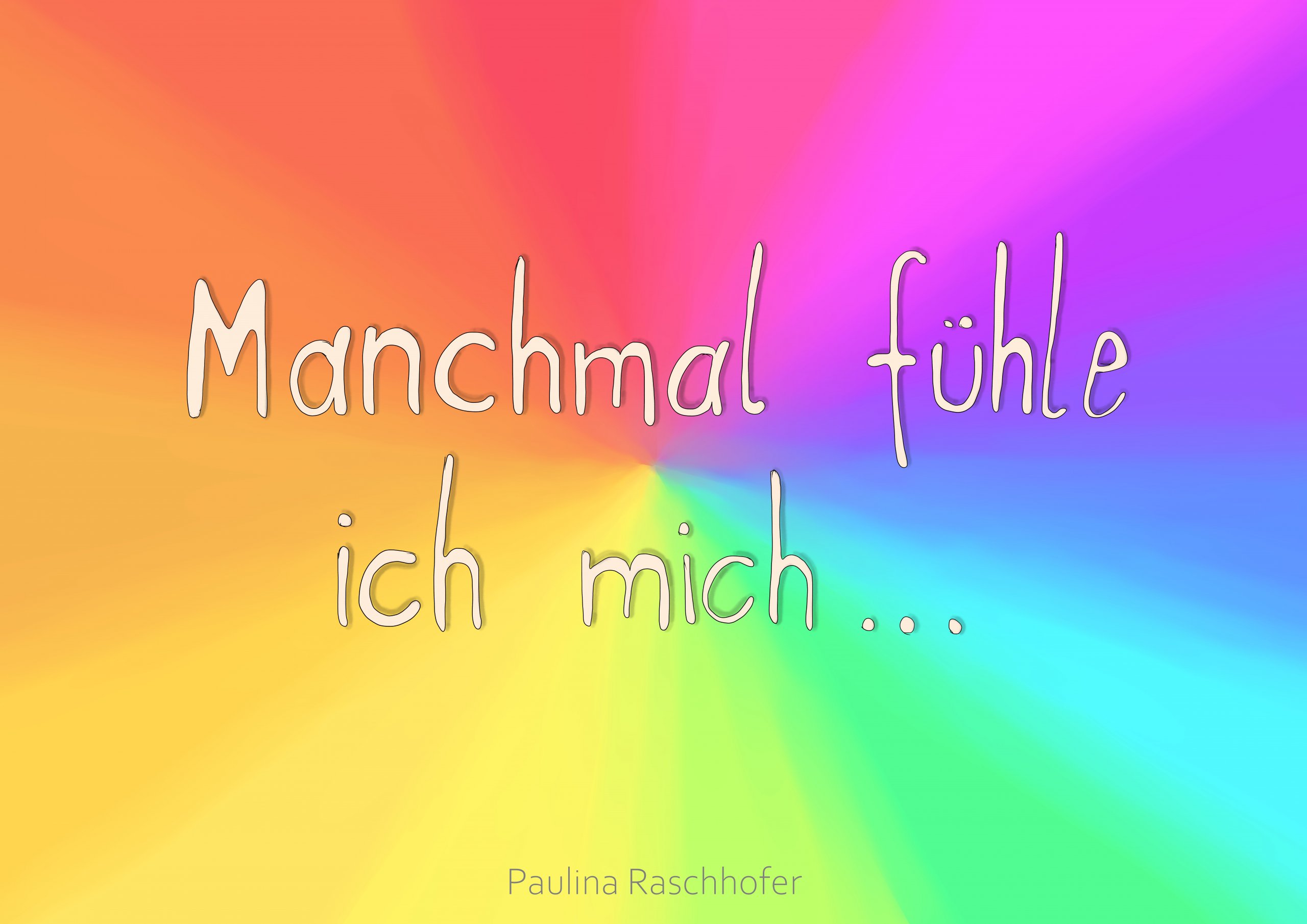Wie Leistungsbeurteilungen die Lernmotivation beeinflussen
In dieser Radiosendung führt Elif Türk ein Gespräch mit der Lehrerin und Psychologin Prof. Mag.a Dr.in Poterpin. Im Mittelpunkt des Interviews steht die Frage, wie Motivation und Leistungsbeurteilungen im schulischen Kontext miteinander verknüpft sind. Prof. Poterpin erläutert, inwiefern Leistungsbeurteilungen die Lernmotivation beeinflussen und welche Strategien zur Steigerung der Motivation von Schülerinnen und Schülern, auch ohne den Einsatz von Bewertungen, möglich sind. Darüber hinaus werden motivatonsfördernde Bewertungssysteme vorgestellt, die den Lernprozess unterstützen und die intrinsische Motivation fördern.
Von Pausenbuddys und Konfliktprofis – Freundschaft macht Schule!
Unser Podcast „Pausenbuddys und Konfliktprofis – Freundschaft macht Schule! stellt ein Thema in den Mittelpunkt, das für uns alle im schulischen Alltag von großer Bedeutung ist. Gemeinsam mit zwei Schulleiterinnen aus verschiedenen Volksschulen haben wir daran gearbeitet, die Bedeutung von Freundschaften und sozialen Kompetenzen zu beleuchten und spannende Perspektiven aus der Praxis einzufangen.
Was bedeutet Schenken und welchen Sinn hat es?
In diesem Podcast setzen sich die SchülerInnen der 4B und 2B intensiv mit dem Thema “Schenken” auseinander. In einem lebhaften Austausch reflektieren sie über den Sinn und die Bedeutung des Schenkens, sowohl in der Weihnachtszeit als auch darüber hinaus. Dabei teilen sie persönliche Gedanken, Geschichten und Erfahrungen, die die Bedeutung des Gebens und der Freude am Teilen verdeutlichen.
Musikalisch untermalt wird der Podcast durch das gemeinsame Singen beliebter Weihnachtslieder, die eine festliche und herzliche Stimmung erzeugen. Diese musikalischen Beiträge zeigen nicht nur das Talent der SchülerInnen, sondern laden die HörerInnen dazu ein, in die weihnachtliche Atmosphäre einzutauchen.
Ein weiteres Highlight der Folge sind die vorgetragenen Texte der Autorin Elke Bräunling. Die Geschichten wie Ein kleines Licht, Friedensglöckchen zur Weihnacht, Die Überraschungstanne im Garten von Oma Klein und Die Weihnachtslichter im Garten von Oma Klein vermitteln wichtige Werte wie Frieden, Überraschung, Zusammenhalt und die Schönheit kleiner Gesten.
Der Podcast kombiniert nachdenkliche Diskussionen, emotionale Geschichten und festliche Musik zu einem stimmungsvollen Gesamterlebnis, das die HörerInnen inspiriert und die Weihnachtszeit aus neuen Blickwinkeln beleuchtet.
Von Klassenzimmer zu Klassenzimmer
Wie unterschiedlich erleben Kinder ihre Volksschulzeit in verschiedenen Ländern? In diesem Podcast werfen wir einen Blick über den Tellerrand und vergleichen Schulsysteme weltweit. Gemeinsam mit unseren Gästen, Antje aus Deutschland und Alexandru aus Rumänien, sprechen wir über die Unterschiede im Unterricht, das Notensystem und wie Volksschule aus der Sicht von Lehrkräften und Schüler*innen erlebt wird. Ein spannender Einblick in die Welt des Lernens!
Die Wundertage vor Weihnachten
Im folgenden Podcast ist unsere Freundin Julia zu Gast. Julia hat eine ganz besondere (Vor-) Weihnachtszeit, von welcher sie uns heute erzählt. Taucht ein in Julia’s wundervolle Weihnachtswelt und lasst euch überraschen von ihrer Geschichte!
Zielgruppe: ab der 3. Klasse Volksschule für jeden
Mit Freude lehren, dem Stress entbehren – Prävention von Burnout im Schulalltag
In unserem Podcast tauchen wir tief in die Herausforderungen des LehrerInnen-Berufs ein, mit besonderem Fokus auf die Primarstufe. Gemeinsam mit unserem Gast Erich Schönbächler beleuchten wir Ursachen, Anzeichen und Präventionsstrategien rund um Burnout.
Erich teilt seine persönliche Geschichte und gibt praktische Tipps, wie LehrerInnen ihre Resilienz stärken, Stress bewältigen und neue Kraft schöpfen können. Dabei geht es nicht nur um individuelle Ansätze, sondern auch um die Bedeutung kollegialer Unterstützung und institutioneller Hilfe.
Freue dich auf wertvolle Einblicke, authentische Geschichten und hilfreiche Ratschläge, die Mut machen und Wege aufzeigen, den Schulalltag mit Freude und Gesundheit zu meistern.
Zielgruppe: LehrerInnen, Schulleitungen, pädagogische Fachkräfte sowie Eltern und Bildungsinteressierte.
Gemeinsam gegen Mobbing
In unserem Podcast haben wir, Julia und Mariam, zusammen mit vier Kindern aus der Volksschule Konstanziagasse über das Thema Mobbing gesprochen. Gemeinsam haben wir Fakten, persönliche Erfahrungen und Möglichkeiten diskutiert, wie wir Mobbing erkennen und aktiv dagegen vorgehen können.
Der Podcast richtet sich an Kinder, Eltern, Lehrer:innen und alle, die an einem harmonischen und respektvollen Miteinander in Schulen interessiert sind. Er sensibilisiert für die Auswirkungen von Mobbing und motiviert Kinder, Eltern und Lehrer:innen, aktiv zu handeln.
Mit Wissen, Mut und Zusammenhalt können wir Mobbing bekämpfen und Schulen zu einem sicheren Ort machen, an dem sich alle wohlfühlen.
*Audio-Lernwerkstatt: FeuerFIT – Brandschutzerziehung im frühen Kindesalter*
Willkommen beim Podcast „FeuerFIT“! In diesem Podcast geht es um mehr als nur Feuerwehrmannschafen und ihre Heldendaten. Hier dreht sich alles um Brandschutzerziehung und wie sie bereits im frühen Kindesalter einen entscheidenden Einfluss haben kann. In dieser Folge haben wir das Privileg, einen erfahrenen Feuerwehrmann zu interviewen, der uns Einblicke in die Welt der Brandschutzerziehung gibt. Gemeinsam erkunden wir die Frage, warum es so wichtig ist, dieses Thema frühzeitig in die Bildung unserer Kinder zu integrieren. Unsere Gespräche decken eine Vielzahl von Themen ab, von der Theorie, warum Brandschutzerziehung im Kindesalter entscheidend ist, bis hin zur praktischen Umsetzung im Klassenzimmer. Wie können Lehrerinnen und Lehrer dieses Thema spannend gestalten und in den Unterricht integrieren? Welche kreativen Methoden gibt es, um Kinder für das wichtige Thema Feuersicherheit zu sensibilisieren? Doch nicht nur in der Schule ist Brandschutzerziehung wichtig. Eltern spielen eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung ihrer Kinder. In unseren Interviews erfahren Sie, wie Eltern aktiv an der Brandschutzerziehung teilnehmen können und welche einfachen Maßnahmen sie zu Hause ergreifen können, um ein Bewusstsein für Sicherheit zu schaffen. Ein weiterer Schwerpunkt unseres Podcasts liegt auf den grundlegenden Notfallmaßnahmen, die Kinder kennen sollten, um im Ernstfall Leben retten zu können. Hören Sie rein, um von Experten auf diesem Gebiet zu lernen und herauszufinden, wie Sie dazu beitragen können, dass unsere Kinder nicht nur fit fürs Feuer, sondern auch FeuerFIT werden. Der Podcast „FeuerFIT“- Ihre Quelle für lebensrettende Informationen und spannende Einblicke rund um Brandschutzerziehung!
Produziert von Studierenden der PH Wien, in der Lernwerkstatt “Auditiv-kreatives Gestalten mit digitalen Medien” (WS 23).
*Audio-Lernwerkstatt: DaF/DaZ zwischen Ansprüchen und Realität*
Herzlich willkommen zu einem fesselnden Gespräch rund um Deutsch als Fremdsprache (DaF) und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) – speziell im Kontext von Deutschförderung in Schulen und der Erwachsenenbildung!
Erfahrt mehr über die Herausforderungen durch komplexe Rahmenbedingungen, mangelnde Ressourcen und die dringende Notwendigkeit eines Umdenkens im Unterricht, wobei es nicht nur um die Kluft zwischen Anspruch und Realität geht, sondern auch um die bedeutsame Integration von Sprachförderung in den gesamten Unterrichtsprozess. Lasst uns erkunden, warum eine individuelle Förderung und umfassende Ressourcen auf allen Ebenen so entscheidend sind, um einen qualitativ hochwertigen Deutschunterricht zu gewährleisten.
Produziert von einer Studierenden der PH Wien, in der Lernwerkstatt “Auditiv-kreatives Gestalten mit digitalen Medien” (WS 23).
Audio-Lernwerkstatt: Moralische Dilemmata
Taucht ein in die Welt des moralischen Zweifels mit unserem Podcast „Moralische Dilemmata“. In unserer neuesten Episode stellen wir uns einem einzigen, aber fragwürdigem moralischen Dilemma, das zum Nachdenken anregt. Diskutiert mit, denkt nach und entdeckt, wo eure moralischen Grenzen liegen. Seid bereit, eure Überzeugungen in Frage zu stellen – in Moralische Dilemmata‘, dem Podcast, der tief unter die Oberfläche blickt.
*Audio-Lernwerkstatt: PH der Zukunft: Wie soll sie aussehen, um qualifizierte und motivierte Lehrer:innen auszubilden?*
In dieser Folge des Podcast-Projekts „Lernwerkstatt“ dreht sich alles darum, wie die PH der Zukunft aussehen sollte, um qualifizierte und motivierte Lehrer:innen auszubilden.
Denn dass an Schulen nicht das gelernt wird, was man zum Leben so braucht, ist ein Vorwurf, der pädagogische Einrichtungen bereits seit der Antike begleitet.
Nur lernen, was man auch sofort anwenden kann? Nur lernen, was nützt? Nur lernen, was der eigenen Situation und Bedürfnislage entspricht?
Ich spreche gemeinsam mit meinem Gast über Kompetenzen, Qualitäten und Angebot vs. Eigeninitiative.
Produziert von einer Studierenden der PH Wien, in der Lernwerkstatt „Auditiv-kreatives Gestalten mit digitalen Medien“ (WS 23).
*Audio-Lernwerkstatt: Die Rolle des Mannes in der Primarstufe: Vorteil oder Nachteil in einer frauendominierten Berufssparte?*
„Männliche Volksschullehrer sind in Österreich leider noch immer eine Seltenheit. Doch wie wird der männliche Lehrer überhaupt wahrgenommen? Dominieren Klischees und Vorurteile das Bild, oder hat ein Mann in der Volksschulklasse doch mehr Vorteile als gedacht? Neben Stimmen aus der Bevölkerung sprechen wir mit einem Wiener Volksschullehrer über das Thema Vorurteile und Chancen im Berufsfeld Volksschullehrer.“
Produziert von Studierenden der PH Wien, in der Lernwerkstatt “Auditiv-kreatives Gestalten mit digitalen Medien” (SS 23).
*Audio-Lernwerkstatt: Was macht künstliche Intelligenz mit uns? ChatGPT in der Schule.*
„In diesem Podcast tauchen wir in die digitale Welt und laden dich ein, in die faszinierende und geheimnisvolle Welt der künstlichen Intelligenz einzutauchen. Gemeinsam werden wir über die Grenzen des menschlichen Verständnisses und das Phänomen der KI diskutieren, um ihre Geheimnisse zu entfesseln und ihre Auswirkungen auf unsere Welt zu ergründen. Es erwarten dich spannende Interviews, wo Erfahrung und Wissen geteilt wird. Sowohl Vorteile als auch ihre potenziellen Risiken und die ethischen Fragen werden diskutiert und kritisch reflektiert. Bist du bereit? Dann lass uns eintauchen!“
Produziert von Studierenden der PH Wien, in der Lernwerkstatt “Auditiv-kreatives Gestalten mit digitalen Medien” (SS 23).
*Audio-Lernwerkstatt: Wenn Verbrechen zur Unterhaltung wird: Das Dilemma von True Crime*
„In unserem True Crime Podcast „Wenn Verbrechen zur Unterhaltung wird: Das Dilemma von True Crime“ diskutieren wir die moralischen Aspekte von True Crime-Serien. Ist es moralisch vertretbar, sich diese Serien anzuschauen und als Unterhaltung anzusehen? Wie sollen wir damit umgehen? Weiters setzen wir uns mit den Auswirkungen auf die Gesellschaft und der Verantwortung der Produzierenden und Zusehenden gegenüber den Opfern und deren Familien auseinander. In dem Interview mit einem „Superfan“ erfahren wir mehr über die Beweggründe und Gedanken zu diesem Thema.“
Produziert von Studierenden der PH Wien, in der Lernwerkstatt “Auditiv-kreatives Gestalten mit digitalen Medien” (SS 23).
*Audio-Lernwerkstatt: Medienbildung, Dialekt und Lodiridari*
„Wer den Medienschwerpunkt an der Pädagogischen Hochschule Wien gewählt hat, kennt ihn bestimmt. Erich ist ein Professor mit Herz. Er ist für seine praxisnahen Seminare und Übungen bekannt. Mit dieser Podcast-Folge wollen wir jedoch ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wer ist dieser Erich Schönbächler denn wirklich? In dieser Folge erfahrt ihr mehr über das Leben Erichs und wieso, weshalb, warum es ihn nach Wien verschlagen hat. Sein Dialekt und seine Biografie ganz allgemein sind großer Bestandteil der Folge. Ebenso wird seine Expertise zum Thema Spielsucht Bestandteil des Podcast sein.“
Produziert von Studierenden der PH Wien, in der Lernwerkstatt “Auditiv-kreatives Gestalten mit digitalen Medien” (SS 23).
*Audio-Lernwerkstatt: PHlaudertaschen*
„Wir sind die PHlaudertaschen mit PH und deine zukünftigen Studienkolleginnen. Wir freuen uns sehr, dass du den Weg zur PH Wien gefunden hast. In diesem Podcast möchten wir dir von unserem Studienstart berichten und dir nützliche Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Gemeinsam sprechen wir über Stundenpläne, Raumnummern und die kleinen Missgeschicke, die uns passiert sind. Mit spannenden Interviews geben wir dir einen Einblick in das Studium an anderen Unis und einen Blick hinter die Kulissen mit Claudia, einer Mentorin aus Niederösterreich. Wir bedanken uns bei unseren Interviewpartner:innen Annika, Laurenz und Claudia. Ein besonderer Dank geht an Alex. Vielen Dank, dass du unser Gast warst und uns so toll geholfen hast!
Produziert von Studierenden der PH Wien, in der Lernwerkstatt “Auditiv-kreatives Gestalten mit digitalen Medien” (SS 23).
*BB Talks: Interview mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom HLG „Persönlichkeitsentwicklung und Empowerment“*
Podcast: Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom HLG „Persönlichkeitsentwicklung und Empowerment“
Episode 7: Miteinander, Handlungsmöglichkeiten für inklusiven Unterricht in der beruflichen Bildung
Es kommt auf die Haltung an.
Ich spreche mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern von „Persönlichkeitsentwicklung und Empowerment“ über die Erfahrungen mit diesem neuen Hochschullehrgang.
in der ersten Episode der Berufsbildungs Talks, sprach ich mit Ursula Sillaber über die Inhalte des Hochschullehrgangs „Persönlichkeitsentwicklung und Empowerment“. Der Lehrgang begann im heurigen Sommersemester und so dachten wir, dass es doch spannend wäre mit Teilnehmer*innen des Lehrgangs über ihre Erfahrungen zu sprechen. Als erstes interviewte ich zwei Pädagoginnen mit einiger Berufserfahrung.
Persönlichkeitsentwicklung und Empowerment ist auch für die jüngeren Kollegen von Interesse. Der Bedarf an den Schulen ist gegeben, denn im Lehrberuf ist die Ausbildung nie zu Ende.
Dabei stehen Teamfähigkeit und Teamgeist ganz oben auf der Liste der Anforderungen für den alltäglichen Schulbetrieb.
Teamfähigkeit und Teamgeist stärken, ich sprach mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Hochschullehrgangs Persönlichkeitsentwicklung und Empowerment über ihre Erfahrungen.
*BB Talks: Inklusiv*
Episode 6: Miteinander, Handlungsmöglichkeiten für inklusiven Unterricht in der beruflichen Bildung
Es geht darum heraus zu finden, was die Schüler*innen können und nicht was sie nicht können
Eine Gespräch mit Frau Professorin Doktorin Sabine Albert und Herrn Professor Doktor Jure Purgaj von der Pädagogischen Hochschule Wien.
*BB Talks: Kryptoökonomie*
Episode 5: Kryptoökonomie.
Ein Gespräch mit Univ. Prof. Dr. Alfred Taudes über:
Blockchain ist mehr als Bitcoin & Co, ein Ausblick auf die Möglichkeiten Kryptoökonomie.
*Erklärvideo: What is GreenComp Competence Framework (European Commission)*
A video from the TAP-TS project (ZLI/PH Vienna)
In this video the competence framework „GreenComp“ of the European Commission is briefly presented.
The video serves as an introduction for all stakeholders of the TAP-TS (Erasmus+) project. The video was created by Karolin Terwey.
For further questions contact: Klaus Himpsl-Gutermann
*BB Talks: Des Kaisers neue Kleider?*
Episode 4: Des Kaisers neue Kleider?
Des Kaisers neue Kleider? Ein Gespräch mit Prof. Dr. Purgaj über Virtueller Mode als Ausweg für die ressourcenhungrige Modeindustrie.
*BB Talks: Lehramtsstudium*
Episode 3: Lehramtsstudium
Ein attraktives Angebot mit ausgezeichneten Jobchancen.
Gespräch mit Fr. Prof. Di Giusto über das Lehramtsstudium Information und Kommunikation, angewandte Digitalisierung.
*Manchmal fühle ich mich …*
Im Zuge meiner äquivalenten Bachelorarbeit mit dem Titel „Über Gefühle sprechen. Wie Bilderbücher in der Primarstufe eingesetzt werden können, um sozial-emotionale Kompetenzen zu fördern“ erstellte ich ein Bilderbuch mit dem Titel „Manchmal fühle ich mich …“.
Das Buch thematisiert diverse Gefühle und lädt zum Reflektieren und Besprechen dieser ein. Das gesamte Buch befindet sich im Anhang.
*BB Talks: Vignettenforschung*
Episode 2: Vignettenforschung
In dieser Podcast-Episode spricht Martin Thoma mit Frau Dr. Thielmann von der PH Wien und Frau Dr. Agostini von der Universität Wien über Vignettenforschung.
Was sind Vignetten, was sind Vignetten nicht?
Mit Vignetten sind auf keinen Fall österreichische Autobahnvignetten gemeint. Vignetten sind verdichtete, prägnante Beschreibungen einer ausgewählten Erfahrungsszene, das heißt, sie sind bespielhafte Beschreibungen. Und als Beispiel haben Vignetten den Anspruch, einen allgemeinen Sinn in einer besonderen und konkreten Erfahrungssituation aufleuchten zu lassen. Das heißt, aus der einen Vignette bzw. aus der konkreten Erfahrungssituation kann daraus auch etwas für andere Situationen gelernt werden.
*BB Talks*
Berufsbildung hörbar machen
Mit dem Podcast „BB Talks – Berufsbildung hörbar machen“ wollen wir die sich künftig für die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung ergebenden Herausforderungen und Chancen ins Gespräch bringen. Unser Ziel ist es, Interessierten Einblicke in die komplexe und vielfältige Welt der Berufsbildung zu ermöglichen und ihnen so die Gelegenheit zu geben, eine neue Sichtweise auf eine meist wenig vertraute Materie zu entwickeln. Unter dem Motto „Gleichwertig aber nicht gleichartig“ wollen wir zum besseren Verstehen des Verhältnisses von Berufsbildung und (Hoch-)Schule und zur Überwindung der Kluft zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung beitragen.
Episode 1: Hochschullehrgang „Persönlichkeitsentwicklung und Empowerment“
In dieser Podcast-Episode spricht Martin Thoma mit Ursula Sillaber über die Inhalte des Hochschullehrgangs „Persönlichkeitsentwicklung und Empowerment“. Der Lehrgang soll im Sommersemester 2022 starten. Als Lehrgangskoordinatorin ermöglicht Ursula Sillaber einen Blick hinter die Kulissen.
*Postkolonialität und Digitalität: Vortrag von Noam Gramlich im Medienarchiv der PH Wien*
Tsumeb ist eine Stadt in Namibia mit etwa 20.000 Einwohner:innen und bekannt für ihr Abbaugebiet von Kupfer. Kupfer, das in rauen Mengen geschürft und für die Erbauung der Telekommunikationsinfrastruktur Europas eingesetzt wurde. Tsumeb ist auch heute noch von der Geschichte als Bergbaustadt geprägt. 2021 hat Noam Gramlich, MA (Universität Potsdam) die Stadt besucht und dort für ihre Promotion geforscht.
Über diese Erfahrungen hat Naomie Gramlich im Rahmen eines Vortrags unter dem Titel „Postkolonialität und Digitalität“ in der Lehrveranstaltung „Medienhandeln zwischen Recht, Politik und Umwelt“ (Schwerpunkt „Medienbildung und Informatische Grundbildung“ am 21.01.2022 gesprochen. Im Zentrum des Vortrags stand die Frage postkolonialer Verwicklungen einer Mediengeschichte des Globalen Nordens, der Bedeutung von Rohstoffen und Materialität und der Kunst von Otobong Nkanga. Der Vortrag ist über das Medienarchiv der PH Wien HIER frei verfügbar.
Weitere Informationen über Nina Grünberger (ZLI PH Wien).
*Podcast: „Freispiel macht Schule“ – Die andere Schulpraxis*
In diesem Podcast beantwortet Prof. Mag. Claudia Leditzky wichtige Fragen zur Absolvierung der Schulpraxis im Rahmen des Projekts „Freispiel macht Schule“, einer Kooperation des Vereins Freispiel mit der Pädagogischen Hochschule Wien.
Das Interview führt Bernhard Goll, Studierender an der PH Wien und selbst ehemaliger Teilnehmer am Projekt „Freispiel macht Schule“.
*Hörspiel: Rumpelstilzchen*
Dieses Hörspiel entstand im Rahmen des Schwerpunkts im Seminar Auditiv-kreative Gestaltung mit digitalen Medien.
Viel freude beim Reinhören und genießen.
*Digital LEVEL-UP Licence-Erklärvideo: PDFs ausfüllen mit Acrobat Reader*
PDFs ausfüllen mit Acrobat Reader.
*Digital LEVEL-UP Licence-Erklärvideo: Wie suche ich sinnvoll im Internet?*
Wie suche ich sinnvoll im Internet?